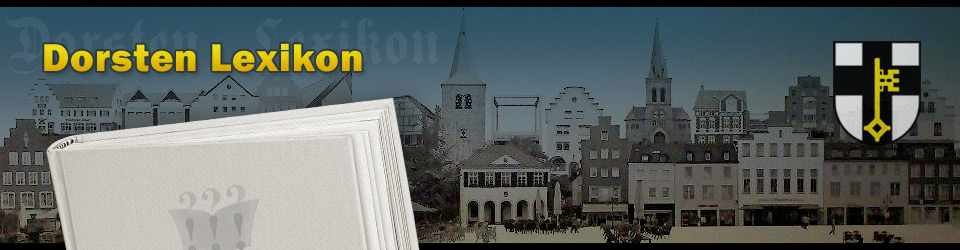Die beiden Ortsteile trennt der Bindestrich und der Rapphofs Mühlenbach
Hervorgegangen ist der Ort aus Höfen, die teils dem Stift Xanten (Höfe Gut Bonekamp 13. Jahrhundert, Middendorp, Hagemann) und dem Reichshof Dorsten (Höfe Kuckelmann 13. Jahrhundert) abgabepflichtig waren, teils an Kurköln (Höfe Breil 1545, Schulte Kellinghausen und Nachbarschulte) und an die Abtei Essen und Werden (Gut Bellendorf). Im Jahr 1255 tritt ein „Bertoldus de Kellinchusen“ in Recklinghausen als Gerichtsschöffe auf. Der Hof Wieskamp war nach Urkunden aus dem 16. Jahrhundert Eigentum der Familie von Westerholt.
Zum Stift Xanten gehörten das Gut Bonekamp, im 15. Jahrhundert Middendorp, seit 1907 Dönnebrink genannt, sowie zwei Höfe Hagemann, getrennt durch „ein Essensches Gut, das Ulfkotte bewohnt“ (1545). Einen der Höfe hatte 1401 Naldo von Ulfkotte, 1545 Claes ten Haeghen unter, der 1563 an die Familie Wulf gekommen ist. Auch die Höfe Schulte Kuckelmann (im 13. Jahrhundert „scultetus Kukelem“), seit 1895 im Besitz von Schulte Hemming, und Besten hatten an den Reichshof Dorsten Abgaben zu entrichten, während das Gut Bellendorf („belinctorppe“), das um 1500 an die Familie Föcker (Vöcking) überging, von Werden lehnrührig war. Der mit Tönsholt heute 1.232 Hektar große Stadtteil ist aus zwei Bauerschaften hervorgegangen. Sie gehörten zur Pfarrgemeinde St. Agatha, während Altendorf-Ulfkotte 1837 zum Amt Marl gekommen ist. Als 1837 die Stadt Dorsten infolge der in Kraft getretenen preußischen revidierten Städteordnung von 1831 aus dem Verband der Bürgermeisterei Dorsten, zu der seit 1820 die Bürgermeisterei Marl gehörte, ausscheiden musste, verblieb Altendorf-Ulfkotte – die beiden Ortsteile trennt der Rapphofs Mühlenbach – mit der ehemaligen Bürgermeisterei Marl bei der Verwaltung Dorsten-Land. Die endgültige Trennung erfolgte 1844. Aus der Verwaltung wurde das Amt Marl.
Bei der kommunalen Neuordnung kam Altendorf-Ulfkotte 1975 als Stadtteil zu Dorsten. Die Einwohnerzahl ist von1850 bis 1928 auf 849 angewachsen. Heute hat der Stadtteil rund 2.000 Einwohner. Das ländlich strukturierte Altendorf-Ulfkotte hat eine katholische und evangelische Kirche, die „Kardinal von Galen“-Grundschule sowie eine Mehrzweckhalle. Der Schützenverein wurde schon 1652 gegründet. 1965 entstand die Siedlung „Rote Erde“. Seit Jahrzehnten hat Altendorf-Ulfkotte massive Bergschäden zu verzeichnen, die auch nach Einstellung des Abbaus unter Altendorf-Ulfkotte Anfang 2009 anhalten. Seit 1979 sank die Dorfmitte etwa um 1,30 Meter; extreme Bergsenkungen im Außenbereich liegen bei 11,50 Metern.
Bergsenkungen: Seit etlichen Jahren Probleme mit dem Erdbach
Wegen der durch Bergsenkungen verursachten geänderten Fließrichtung musste der Erdbach verlegt werden, um künftig bereits weiter südlich in Rapphofs Mühlenbach zu münden. Die Arbeiten dafür haben Ende 2010 begonnen und wurden 2012 fertiggestellt. Die Kosten in Höhe von 3,4 Millionen Euro trug die Ruhrkohle AG. Die 1.800 m lange neue Bachtrasse führt südlich und östlich an Altendorf vorbei. Ein Pumpwerk war nötig geworden, um das Wasser des Erdbachs an seiner Mündung in den Rapphofs Mühlenbach zu heben, bis dieser voraussichtlich 2016 vertieft wird. Durch Bergsenkungen ist der Erdbach in der Dorfmitte in eine so genannte Sattellage geraten, das heißt, er fließt von seiner höchsten Stelle in beide Richtungen ab. Der Grundwasseranschluss reicht hier nicht mehr aus, damit der Bach dauerhaft Wasser führt. Derzeit wird durch ein von der Ruhrkohle betriebenes Pumpwerk Wasser in den Lauf gepumpt, der nach der Verlegung der Haupttrasse keine Bedeutung mehr als Bach im eigentlichen Sinne hat. Im Juni 2016 diskutierte die Stadt mit den Altendorfern über die künftige Sanierung des Erdbachs.
Neues Wohnbaugebiet auf einer Freifläche an der Altendorfer Straße
Lange ruhte das Thema Wohnbaugebiet zwischen Gräwingheide, Altendorfer Straße und Am Erbach in der Verwaltung und den Medien. Im ersten Quartal 2016 ist auf Initiative von Altendorfer Bürgern wieder Bewegung aufgekommen. Es hat Gespräche zwischen Grundeigentümern, der Stadt, einem Planungsbüro sowie möglichen Erschließungsträgern gegeben. In dem o. g. U-förmigen Bereich sollen auf 40 Baugrundstücken etwa 75 Wohneinheiten entstehen, zumeist Ein- und Zweifamilienhäuser. Mit der Realisiserung ist eng verknüpft mit der Planung, wie künftig der Erdbach-Mittellauf, der das Baugebiet begrenzt, gestaltet wird.
Verfahren läuft: Neubaugebiet für 60 Wohneinheiten in Altendorf-Ulfkotte
Derzeit wird die 3,4 Hektar-Fläche zwischen Altendorfer Straße, Wohngebiet Gräwingheide, Grundschule und Erdbach in Altendorf-Ulfkotte noch landwirtschaftlich genutzt. Doch schon bald soll sie von der städtischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft WinDor mit 60 Wohneinheiten bebaut werden. Vor allem zweigeschossige Ein- und Zweifamilienhäusern, aber auch einige Mehrfamilienhäuser mit höchsten drei Geschossen sind geplant. Die Erschließung soll sowohl über die Altendorfer Straße als auch über die Straße „Im Päsken“ erfolgen. Ein Fuß- und Radweg führt zur Straße Gräwingheide. Am Erdbach-Lauf ist ein Grünzug geplant, der die Altendorfer Straße mit der Dorfmitte verbinden soll. Durch die Vermarktung durch WinDor – die städtische Gesellschaft hatte vor gut einem Jahr vertraglich Zugriff auf die Flächen bekommen – soll sichergestellt werden, dass vor allem Familien aus Altendorf-Ulfkotte und Dorsten zum Zuge kommen. Auch die Umgestaltung des Erdbachs soll in städtischer Hand erfolgen.
Der nächste Verfahrensschritt – die frühzeitliche Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange – soll erfolgen, wenn die Ergebnisse der nächsten Artenschutzprüfung vorliegen. In die Vermarktung gehen sollen die Grundstücke nach Abschluss des Verfahrens. Dabei könnte nach Angaben der Stadt noch zwei Jahre vergehen – vorbehaltlich der Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung.
 Wetterschacht-Gebäude wurden abgerissen und die Fläche wird begrünt
Wetterschacht-Gebäude wurden abgerissen und die Fläche wird begrünt
Die Ära des Steinkohlenbergbaus in Deutschland ist vorbei – und bald wird auch der Schacht in Altendorf nichts mehr zu sehen sein. Anfang 1919 wurde er abgebrochen. Der 1967 abgeteufte und 1970 in Betrieb genommene Schacht Altendorf der ehemaligen Zeche Westerholt (und damit des späteren Bergwerks Lippe) befindet sich unweit des Dorfes an der Altendorfer Straße/Polsumer Weg. Er hat eine Teufe (Bergbau-Ausdruck für Tiefe) von rund 1215 Metern und diente als Wetterschacht, nachdem sich der Kohleabbau von Herten aus in Richtung Polsum und Altendorf bewegt hatte. In einem untertägigen Teilbereich wurde der Schacht zusätzlich zur Seilfahrt von Personen und zum Materialtransport genutzt. Nach der Stilllegung des Bergwerks Lippe Ende 2008 war der Schacht Altendorf, der vor allem zur Be- und Entlüftung gedient hatte, überflüssig geworden. Im Jahr 2009 wurde er mit Beton verfüllt. Zurückblieben sind zehn Gebäude (Schacht- und Lüftergebäude, Absauganlage, Silos, Trafohaus etc.), die in den nächsten sechs Monaten dem Erdboden gleich gemacht werden. Die 2,8 Hektar große Fläche soll lt. RAG Montan-Immobilien nicht für Gewerbezwecke verwendet, sondern begrünt werden.
2018 mit neuer Wirtin von der „Gaststätte Erwig“ zum „Goldenen Bullen“

Ana Simic, neue Pächterin
Die Traditionsgaststätte „Erwig“ wurde Ende Juli 2018 mit neuem Namen und neuer Pächterin wiedereröffnet. Die Gaststätte heißt jetzt „Zum Goldenen Bullen“, die 37-jährige Gastwirtin Ana Simic. Die aus Kroatien stammenden Eltern von Ana Simic waren Gastronomen, sie betrieben das damalige Löwenpark-Balkan-Restaurant in Westerholt, wo Ana Simic schon als 15-Jährige regelmäßig ausgeholfen hatte. Zuvor arbeitete sie im Steakhaus „Argentina“ in Gelsenkirchen-Buer. Neben dem Restaurant- und Hotel-Bereich im „Goldenen Bullen“ läuft der Gaststätten-Betrieb mit Stammtischen, Fußballübertragungen, Kegelbahn und Schützen-Lokal wie gehabt weiter.
Fahrbahn-Erneuerung der Altendorfer Straße deutlich minimiert
Eigentlich wollte „Straßen.NRW“ die Fahrbahn der Altendorfer Straße (L 601) im Brückenbereich des Rapphofs Mühlenbach zwischen Einmündung Polsumer Weg und Hof Schulte-Hemming auf einer Länge von 230 Metern neu asphaltieren – doch daraus wird nichts, verkündete die Behörde im August 2019. Die Landstraße wird nun lediglich auf einem 25 Meter langen Teilstück erneuert. Der Grund: Die Straße müsste 18 Monate lang voll gesperrt werden. Dagegen hatten sich 2017 Altendorfer Bürger erfolgreich gewehrt, weil Berufspendler Richtung Marl und Landwirte einen mehrere Kilometer langen Umweg über Polsum hätte fahren müssen.
Riesige Kunststoff-Recyclinganlage kommt auf Altendorf-Ulfkotte zu
Die Firma BP plant eine Recycling-Anlage für Kunststoff im nordöstlichen Bereich ihres Raffineriegeländes. Das grenzt direkt an Dorstener Stadtgebiet am Stadtteil Altendorf-Ulfkotte. Mit diesem Projekt errichtet BP Akzente mehr als 100 Arbeitsplätze. Das wurde bei der Stadtteilkonferenz Ende März 2022 deutlich. Die Anlage soll 800.000 Tonnen Plastik verwerten. Dementsprechend hoch dürfte das Verkehrsaufkommen mit etwa 200 Lkw täglich sein, um an der Stadtgrenze von Altendorf-Ulfkotte Material für die Anlage zwischen Autobahn 52, Auf der Kämpe in Gelsenkirchen und Altendorfer Straße in Dorsten anzuliefern. Die Einwohner protestieren gegen den Bau der Anlage. Mehr dazu im Lexikon-Eintrag Altendorf-Ulfkotte / riesiger Konverter.
Heilig-Kreuz-Kirche in Altendorf-Ulfkotte soll ein Denkmal werden
Die Franziskanerkirche in der Lippestraße, die Kirche St. Ewald in Rhade, die Kreuzkirche in Hervest, das Evangelische Gemeindezentrum in Wulfen-Barkenberg – sie alle haben etwas gemeinsam: Sie gehören laut Auffassung des zuständigen Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe neuerdings zu den kirchlichen Nachkriegsbauten in Dorsten, die unter Denkmalschutz gehören. Nun soll die katholische Heilig Kreuz-Kirche in Altendorf hinzukommen. Die von dem Dorstener Architekten Professor Manfred Ludes entworfene Kirche wurde 1972/73als Nachfolgerin der 1938 errichteten Vorgänger-Kirche gebaut, die von der Evangelischen Kirchengemeinde genutzt wird. Das Gebäude der Heilig-Kreuz-Kirche veranschaulicht mustergültig das nicht-hierarchische Kirchenbild der 1970er-Jahre. Das heißt Kirche ohne einen bestimmenden Turm, ohne repräsentativen Vorplatz. Als Gründe für den Denkmalschutz führt das Denkmalamt ins Feld, dass die „wissenschaftliche Bedeutung für die architekturhistorische und religionssoziologische Forschung in erheblicher Weise vorhanden“ sei. Dazu gehören „der konsequente Verzicht auf Bildwerke zugunsten des Gedankens, das Kreuz Christi als Grundriss selbst“ zur Grundlage eines Architekturentwurfs zu machen, der Charakter des Dach-Zeltes „als Sinnbild des wandernden Gottesvolkes“, die dreiseitige Stellung des Gestühls um eine nur wenig angehobene Altarinsel und die zurückhaltende, wenig repräsentative Verwendung von Materialien im Sinne eines Verzichts auf überkommene Repräsentationsgesten“.
2024 Gemeindefest Heilig Kreuz in Altendorf-Ulfkotte
Der Gemeindeausschuss Heilig Kreuz veranstaltete am Wochenende 14./15. September 2024 ein Gemeindefest. Am Samstag begann das Fest um 19 Uhr mit einer Party im Pfarrheim und draußen. Für Musik sorgte DJ Dennis Finke von Lineupevents. Es gabt einen Grillstand, einen Getränkewagen und Kiosk Mummel bot eine Weinbar, Trendgetränke sowie Mummeltüten an. Der Sonntag startete um 11 Uhr mit einem Familiengottesdienst, an dem auch ein Kinderchor teilnahm. Danach boten verschiedene Gruppen Programme an, Kinder konnten spielen und wurden geschminkt. Es gab unter anderem eine Hüpfburg, Kutschfahrten, die Möglichkeit zum Stockbrotbacken und die Feuerwehr war als besondere Attraktion anwesend. Der Schießkeller war geöffnet und es gab Livemusik mit André Wemhoff. Mehrere Vereine und Gruppen trugen zum Fest bei. Der erwirtschaftete Erlös wurde für die Kinder- und Jugendarbeit in Altendorf-Ulfkotte verwendet.
Wappen der Gemeinde wurde erst 1987 von Wolf Stegemann kreiert
Der schwarzgrundige Schild ist diagonal mit einem silbernen, gewellten Balken geteilt. Er stellt den Rapphoffs-Mühlenbach dar, der die beiden Ortsteile in etwa trenntt. Im linken oberen Feld ist eine  silberne Hülsekrabbe und im rechten unteren eine Pflugschar zu sehen. Beide Symbole dokumentieren den ländlichen Charakter des Stadtteils. Die Gemeinde hatte kein Wappen. Erst durch Wolf Stegemann, Redakeur bei den Ruhr-Nachrichten (DZ) und von 1980 bis 1990 wohnhaft in Altendorf-Ulfkotte, wurde 1987 über einen Leserwettbewerb der „Ruhr-Nachrichten“ Vorschläge für ein Wappen erbeten, das dann von Wolf Stegemann zusammengestellt wurde. Der Rat der Stadt Dorsten akzeptierte offiziell das Altendorf-Ulfkotter Wappen. Es hängt mit den Wappen der anderen Stadteile und der Dorstener Partnerstädte im Ratssaal des Rathauses.
silberne Hülsekrabbe und im rechten unteren eine Pflugschar zu sehen. Beide Symbole dokumentieren den ländlichen Charakter des Stadtteils. Die Gemeinde hatte kein Wappen. Erst durch Wolf Stegemann, Redakeur bei den Ruhr-Nachrichten (DZ) und von 1980 bis 1990 wohnhaft in Altendorf-Ulfkotte, wurde 1987 über einen Leserwettbewerb der „Ruhr-Nachrichten“ Vorschläge für ein Wappen erbeten, das dann von Wolf Stegemann zusammengestellt wurde. Der Rat der Stadt Dorsten akzeptierte offiziell das Altendorf-Ulfkotter Wappen. Es hängt mit den Wappen der anderen Stadteile und der Dorstener Partnerstädte im Ratssaal des Rathauses.
Siehe auch: Stadtteile
Siehe auch: Hürfeldhadte
Siehe auch: Bürgerinitiative Hürfeldhalde
Siehe auch: Wahlplakat Halde
Siehe auch: Jürgen Diemke
Siehe auch: Siedlung Rote Erde
Siehe auch: Billa Krüger-Mogk
Siehe auch: Altendorf-Ulfkotte / riesiger Konverter