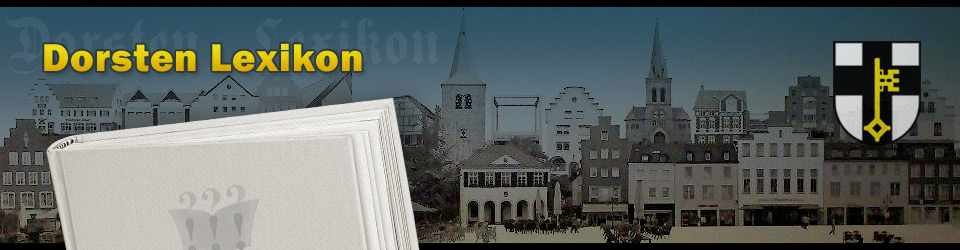2016 erreichten die Kreis-Polizeileitstelle Recklinghausen 177.516 Anrufe

Seit 50 Jahren gibt es für Hilfesuchende in ganz Deutschland drei Ziffern, um am Telefon die Feuerwehr, einen Krankenwagen oder die Polizei zu rufen – 110 und 112. Am 20. September 1973 beschloss die Ministerpräsidentenkonferenz im Beisein des damaligen Bundeskanzlers Willy Brandt die bundesweite Einführung der 110 und 112. Eine zentrale und gebührenfreie Notrufnummer war seinerzeit keine Selbstverständlichkeit: Anfang der 1970er-Jahre war die Polizei nur in rund 1000 von 3785 Fernsprechortsnetzen unter der 110 zu erreichen. Das geht aus einem Bericht der Bundesregierung wenige Monate vor Einführung der Rufnummern hervor. Ansonsten müssen Betroffene im Notfall erst einmal den richtigen Kontakt suchen, etwa im Telefonbuch. Dreistellige Nummern waren damals aus technischen Gründen die kürzesten, die bundeseinheitlich zur Verfügung stehen. Außerdem hat die 110 den Vorteil, dass sie sich an den damals verbreiteten Telefonen auch im Dunkeln leicht wählen lässt: Die Ziffern 1 und 0 befinden sich auf der Wählscheibe an den jeweiligen Enden der Skala.
Grundsätzlich existiert die 110 für die Polizei schon seit 1948. Als die 110 für Polizei und 112 für Feuerwehr ausgewählt wurden, wurde demnach die Ziffernfolge 111 außen vorgelassen, um offenbar technische Probleme zu vermeiden. In der DDR war ab etwa Mitte der 1970er-Jahre neben der 110 und 112 über die 115 der zentral gesteuerte Rettungsdienst zu erreichen. Nach der Wende wurde diese sogenannte „Schnelle Medizinische Hilfe“ aufgelöst. Bis in Westdeutschland die 110 und 112 nach dem Beschluss von 1973 tatsächlich überall verfügbar waren, dauerte es noch einige Jahre. Nach Angaben der Björn Steiger Stiftung, die sich maßgeblich für die einheitlichen Notrufnummern einsetzte, wurde das letzte Ortsnetz Ende 1979 damit ausgestattet.
Tod des Sohnes bewirkte den Einsatz für einheitliche Notfallnummern
Ute und Sigfried Steiger gründeten die Organisation 1969, mit der sie eine gleiche Notfallnummer in der Bundesrepublik dann einführten, nachdem ihr achtjähriger Sohn Björn wegen eines Verkehrsunfalls ums Leben gekommen war. Der Krankenwagen kam erst nach einer Stunde und das Kind starb auf dem Weg in die Klinik an einem Schock. Weil das Elternpaar danach feststellte, dass stundenlanges Warten auf Hilfe die Regel war, starteten sie ihr Engagement für eine bessere Notfallhilfe in Deutschland und forderten bei Politikern die bundesweiten Notrufnummern. Mittlerweile gehen rund 41.000 Anrufe an einem durchschnittlichen Werktag bei Notrufzentralen in Deutschland ein, zeigen Ergebnisse eines Forschungsprojekts der Bundesanstalt für Straßenwesen für die Jahre 2016 und 2017. Am Wochenende seien es etwa 10.000 Anrufe weniger. Demnach stufte das Leitstellenpersonal 52,5 Prozent des Einsatzaufkommens als Notfälle ein. Problematisch sei, dass zu viele Menschen den Notruf auch in weniger gravierenden Situationen riefen, wie etwa bei Kopfschmerzen. Früher hätte die Bevölkerung eine hohe Hemmschwelle bei Notrufen gehabt, doch seit ungefähr 15 Jahren gibt es das umgekehrte Phänomen.
Das deutsche Engagement um die Notrufnummern setzte sich schließlich europa- und sogar weltweit durch. Knapp 20 Jahre später übernahm die EU das deutsche Vorbild einer zentralen Notrufnummer – m und die Ziffernfolge gleich mit. Seit 1991 gilt europaweit die 112m und egal, wo auf der Welt man diese Nummer wählt: Immer wird der Anruf auf die örtlich gültige Notfallnummer umgeleitet, in den USA etwa auf die 911.
Doch die Vorreiterrolle des deutschen Notrufs hat in den aktuell vergangenen Jahren arg gelitten. „Heute ist unser System komplett veraltet, wir sind stehengeblieben“, sagt Pierre-Eric Steiger, Sohn der Stifter und Präsident der Björn-Steiger-Stiftung, die sich immer noch um die Verbesserung der Hilfe in Notfällen kümmert. Andere Länder hätten ihre Systeme schon um 2000 digitalisiert. In Deutschland kommunizieren Rettungsstellen untereinander immer noch per Fax.
„Polizeiruf 110“ – über den Fernseher in die Wohnzimmer
Der „Polizeiruf 110“ läuft nicht bei irgendwelchen Leitstellen der Polizei ein, sondern er flimmert in die Wohnzimmer. Diese deutschsprachige Kriminalfilmreihe war 1971 bis 1990 im DDR-Fernsehfunk (DFF) zu sehen. Nach der Wiedervereinigung übernahmen verschiedene ARD-Anstalten die DDR-Filme und produzierten dann neue Folgen als Gegenstück zu den „Tatort“-Krimis. Sie etablierten sich in der gesamtdeutschen Fernsehlandschaft mit einem Marktanteil von 16 Prozent.
Sonderbriefmarke erschienen
Diese Kriminalreihe mag dazu beigetragen haben, dass sich der echte Polizeiruf 110, der allerdings Notruf 110 heißt in der Bevölkerung angenommen wurde und sich seit seiner Einführung 1973 (daher Notrufsystem 73) und mit den Nummern 110 und 112 als Notruf durchgesetzt hat. Ein Notruf ist ein Signal, das übermittelt wird, um bei einem Notfall professionelle Helfer wie Rettungsdienste, Feuerwehren oder die Polizei zu alarmieren. Je nach Situation wird bei der Rufannahme entschieden, ob ein Einsatz erfolgt. Seit 1991 gibt es in allen Ländern der Europäischen Union (EU) sowie in einigen weiteren Ländern in Europa wie in Russland und der Ukraine die einheitliche Eurorufnummer 112. Anlässlich dieses Ereignisses erschien eine Sonderbriefmarke.
Wenn sich jemand im Zusammenhang mit einer Straftat oder einer Gefahrenlage selbst in  einer Notsituation befinden, Zeuge einer solchen Situation ist oder einen entsprechenden Verdacht hat und zur Bewältigung der Lage polizeiliche Hilfe notwendig ist, sollte den Notruf 110 wählen. Wenn akute Notfallsituationen auftreten, in denen unmittelbar Hilfe geleistet werden muss, gilt es die 112 zu wählen – die Nummer des Rettungsdienstes und der Feuerwehr. 2016 mussten Feuerwehr und Rettungsdienst 183.000 Mal ausrücken – das ist deutlich öfter als im Vorjahr. Ein Trend, der schon länger anhält. Vor zehn Jahren gab es noch 60 Prozent weniger 112-Einsätze. Alle drei Minuten klingelt in der Kreisleitstelle das Telefon. In den meisten Fällen handelt es sich um weniger dramatische Einsätze. Zum Beispiel, wenn jemand gestürzt ist, wenn irgendwo ein heruntergefallener Ast die Straße versperrt – oder eine Katze sich nicht mehr vom Baum herunter traut. In solchen Fällen haben Menschen offensichtlich weniger Scheu, die 112 zu rufen, als früher. Damit die Einsätze in Zukunft noch bewältigt werden können, brauchen die Feuerwehren mehr Personal. Daher warb die Feuerwehr 2017 im Kreis mit 160 Plakaten um Nachwuchs. Die Nummer 112 ist inzwischen europaweit der direkte Draht zu schneller Hilfe. Um die Notrufnummer noch bekannter zu machen, hat die Europäische Kommission den 11. Februar, passend zum Datum (11.2.), zum „Europäischen Tag des Notrufs 112“ erklärt. Allein im Kreis Recklinghausen sind in den Anrufbereichen dieser Nummer rund 1900 Menschen ehrenamtlich und 650 hauptamtlich in Rettungsdiensten beschäftigt. Dazu kommen die vielen Freiwilligen der Hilfsorganisationen. Allein 2020 gingen in der Recklinghäuser Leitstelle 137.000 Notrufe über die 112 ein, plus rund 40.000 über die 02361/19-222 wegen Krankentransporten. Das macht durchschnittlich mehr als 20 pro Stunde.
einer Notsituation befinden, Zeuge einer solchen Situation ist oder einen entsprechenden Verdacht hat und zur Bewältigung der Lage polizeiliche Hilfe notwendig ist, sollte den Notruf 110 wählen. Wenn akute Notfallsituationen auftreten, in denen unmittelbar Hilfe geleistet werden muss, gilt es die 112 zu wählen – die Nummer des Rettungsdienstes und der Feuerwehr. 2016 mussten Feuerwehr und Rettungsdienst 183.000 Mal ausrücken – das ist deutlich öfter als im Vorjahr. Ein Trend, der schon länger anhält. Vor zehn Jahren gab es noch 60 Prozent weniger 112-Einsätze. Alle drei Minuten klingelt in der Kreisleitstelle das Telefon. In den meisten Fällen handelt es sich um weniger dramatische Einsätze. Zum Beispiel, wenn jemand gestürzt ist, wenn irgendwo ein heruntergefallener Ast die Straße versperrt – oder eine Katze sich nicht mehr vom Baum herunter traut. In solchen Fällen haben Menschen offensichtlich weniger Scheu, die 112 zu rufen, als früher. Damit die Einsätze in Zukunft noch bewältigt werden können, brauchen die Feuerwehren mehr Personal. Daher warb die Feuerwehr 2017 im Kreis mit 160 Plakaten um Nachwuchs. Die Nummer 112 ist inzwischen europaweit der direkte Draht zu schneller Hilfe. Um die Notrufnummer noch bekannter zu machen, hat die Europäische Kommission den 11. Februar, passend zum Datum (11.2.), zum „Europäischen Tag des Notrufs 112“ erklärt. Allein im Kreis Recklinghausen sind in den Anrufbereichen dieser Nummer rund 1900 Menschen ehrenamtlich und 650 hauptamtlich in Rettungsdiensten beschäftigt. Dazu kommen die vielen Freiwilligen der Hilfsorganisationen. Allein 2020 gingen in der Recklinghäuser Leitstelle 137.000 Notrufe über die 112 ein, plus rund 40.000 über die 02361/19-222 wegen Krankentransporten. Das macht durchschnittlich mehr als 20 pro Stunde.
Rauchmelderpflicht sorgt für mehr Feuerwehreinsätze im Kreis
Die Rauchmelderpflicht seit Anfang 2017 sorgt für mehr Feuerwehreinsätze. In den ersten drei Monaten des Jahres mussten die Einsatzkräfte 50 Mal ausrücken, weil der Rauchmelder gepiepst hatte. Das waren 20 mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. Ein Ärgernis sind die vermehrten Einsätze für die Feuerwehr aber nicht: Man sei froh, dass jetzt mehr Menschen gewarnt werden und den Notruf wählen, sagte ein Sprecher. Seit Jahresbeginn müssen in allen Schlafräumen und Fluren Rauchmelder hängen.
Sieben Polizei-Leitstellenplätze in Recklinghausen sind rundum belegt
Im Polizeipräsidium Recklinghausen gingen 2016 genau 177.516 Notrufe von Bewohnern aus dem Bereich des Polizeipräsidiums ein, also aus dem gesamten Kreis Recklinghausen und der Stadt Bottrop. Davon waren 14.237 Notrufe (8 Prozent) vom Anrufer selbst beendet worden, also ungültig. Die Polizei spricht von „verlorenen Anrufen“ wenn der Anrufer nach fünf Sekunden auflegt, weil der Anruf wegen Überlastung von einem Mitarbeiter er Leitstelle nicht sofort angenommen werden konnte. Die Dunkelziffer dieser „verlorenen Anrufe“ ist  nicht bekannt. Allerdings soll noch bis Ende 2017 die Leitstelle technisch neu und besser ausgestattet werden, damit auch jeder Notruf angenommen werden kann. Die Zahl der 110-Notrufe hat sich in den zurückliegenden Jahren rasant erhöht. In den Jahren 2010/11 verzeichnete die Leitstelle der Kreispolizeibehörde Recklinghausen nur jeweils rund 65.000 Anrufe. Die Polizei führt dies auf die zunehmende Verbreitung und Verfügbarkeit von Mobiltelefonen zurück. Ein Notruf kann von jedem Telefon aus immer kostenlos erfolgen. Münzen oder Telefonkarten sind nicht erforderlich. Dies gilt auch für Mobiltelefone. Im Recklinghäuser Polizeipräsidium gibt es sieben Einsatzplätze zur Entgegennahme von Notrufen, die rund um die Uhr mit Beamten besetzt sind. Diese haben die Erfahrung, dass Samstagabend die Anrufe im Sekundentakt eingehen. Dagegen herrscht am Sonntagemorgen weitgehend Ruhe.
nicht bekannt. Allerdings soll noch bis Ende 2017 die Leitstelle technisch neu und besser ausgestattet werden, damit auch jeder Notruf angenommen werden kann. Die Zahl der 110-Notrufe hat sich in den zurückliegenden Jahren rasant erhöht. In den Jahren 2010/11 verzeichnete die Leitstelle der Kreispolizeibehörde Recklinghausen nur jeweils rund 65.000 Anrufe. Die Polizei führt dies auf die zunehmende Verbreitung und Verfügbarkeit von Mobiltelefonen zurück. Ein Notruf kann von jedem Telefon aus immer kostenlos erfolgen. Münzen oder Telefonkarten sind nicht erforderlich. Dies gilt auch für Mobiltelefone. Im Recklinghäuser Polizeipräsidium gibt es sieben Einsatzplätze zur Entgegennahme von Notrufen, die rund um die Uhr mit Beamten besetzt sind. Diese haben die Erfahrung, dass Samstagabend die Anrufe im Sekundentakt eingehen. Dagegen herrscht am Sonntagemorgen weitgehend Ruhe.
Missbrauch kann bestraft und Einsätze ohne Not müssen bezahlt werden
Das Strafgesetzbuch stellt mit Paragraf 145 den absichtlichen Missbrauch des Notrufs unter Strafe. Prinzipiell gilt, dass der Missbrauch von Notrufen zivilrechtliche Konsequenzen für den Anrufer haben kann. Wenn es zu einem Einsatz kommt, müssen die Kosten dafür übernommen werden, wenn sich herausstellt, dass es sich um einen absichtlichen Missbrauch gehandelt hat.
Leitstelle der Feuerwehr registriert jährlich 130.000 Notrufe
Die Leitstelle der Feuerwehr in Recklinghausen hat 52 Mitarbeiter , die Disponenten arbeiten im Schnitt 48 Stunden pro Woche. 130.000 Notrufe gehen pro Jahr in der Leitstelle ein, bei fast jedem dritten geht es um einen Krankentransport. Etwa 10.000 Einsätze werden von der Leitstelle aus für die Feuerwehren im Kreisgebiet koordiniert. 698 Brandmeldeanlagen sind in der Leitstelle aufgeschaltet. 1600-mal haben die Brandmeldeanlagen im letzten Jahr ausgelöst, mit 15 Krankenhäusern steht das Leitstellenteam in ständigem Kontakt. Die Leitstelle koordiniert und alarmiert im Kreisgebiet zehn Feuerwehren, 24 Rettungswagen, zehn Notarztwagen, 22 Krankentransportwagen und einen Rettungshubschrauber.
Das deutsche Engagement um die Notrufnummern setzte sich schließlich europa- und sogar weltweit durch. Knapp 20 Jahre später übernahm die EU das deutsche Vorbild einer zentralen Notrufnummer – m und die Ziffernfolge gleich mit. Seit 1991 gilt europaweit die 112m und egal, wo auf der Welt man diese Nummer wählt: Immer wird der Anruf auf die örtlich gültige Notfallnummer umgeleitet, in den USA etwa auf die 911.
Doch die Vorreiterrolle des deutschen Notrufs hat in den aktuell vergangenen Jahren arg gelitten. „Heute ist unser System komplett veraltet, wir sind stehengeblieben“, sagt Pierre-Eric Steiger, Sohn der Stifter und Präsident der Björn-Steiger-Stiftung, die sich immer noch um die Verbesserung der Hilfe in Notfällen kümmert. Andere Länder hätten ihre Systeme schon um 2000 digitalisiert. In Deutschland kommunizieren Rettungsstellen untereinander immer noch per Fax
Übersicht über die wichtigsten Notruf-Nummern
Es ist nicht gravierend, falls Sie im Notfall die Feuerwehr anrufen, wenn Sie die Polizei erreichen wollen oder auch umgekehrt. Es wird immer an die richtige Stelle vermittelt.
Notruf der Polizei: 110 – Immer dann, wenn sich eine Notsituation anbahnt, Sie sich bedroht fühlen oder eine Gefahrensituation für Sie oder andere aufgekommen ist.
Rettungsdienst und Feuerwehr: 112 – Bei Unfällen oder Bränden. Unter dieser Nummer erreichen Sie auch europaweit eine Notrufzentrale, die Ihren Anruf an die zuständige Zentrale weiterleitet.
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116 117 – Falls außerhalb der Sprechzeiten ärztliche Hilfe benötigt wird, wählen Sie diese Nummer – sie gilt bundesweit. Dort werden Sie an den nächsten zuständigen Bereitschaftsdienst weitergeleitet.
Die Nummer gegen Kummer: 116 111 – Hier können alle anrufen, die Sorgen haben und sich beraten lassen machen. Das Angebot gilt für Kinder, Jugendliche und Eltern in ganz Deutschland.
Notruf für Hörbehinderte: Für Menschen mit Hör- oder Sprachschädigung bestand früher oftmals ausschließlich die Möglichkeit, im Notfall Hilfe per „Notfall-Fax“ herbeizurufen. Diverse Organisationen bieten im Internet einen Vordruck für ein Notfall-Fax an, welcher ausgedruckt und mit den persönlichen Daten versehen am Faxgerät platziert werden kann. So muss im Notfall lediglich noch die Art der gewünschten Hilfe angekreuzt und das Fax abgesendet werden. Für den mobilen Einsatz eigneten sich dabei insbesondere faxfähige Mobiltelefone oder tragbare Faxgeräte.
Neue Rettungswache geplant: Container sollen Versorgung sicherstellen
„Zwingend“ notwendig ist eine neue Rettungswache im Dorstener Norden. Der Kreis sieht „unverzüglichen Handlungsbedarf“. Helfen soll eine Container-Lösung. Wer in Nordrhein-Westfalen Hilfe benötigt, soll in städtischen Gebieten nicht länger als acht Minuten auf einen Rettungswagen warten müssen. In ländlichen Bereichen sollen spätestens nach zwölf Minuten Sanitäter eintreffen. Doch für die Dorstener Stadtteile Rhade und Lembeck seien diese Hilfsfristen „kaum einzuhalten“. Zu diesem Ergebnis ist der Kreis Recklinghausen als Träger des Rettungsdienstes und der Feuerwehr in Dorsten gekommen. Deshalb gebe es für die nördlichen Stadtteile „einen zwingenden und unverzüglichen Handlungsbedarf“, um eine neue Rettungswache zu erreichen – zumindest interimsweise. Einen entsprechenden Beschluss hatte der Haupt- und Finanzausschuss am 6. Dezember 2023 einstimmig gefasst. Die Suche nach einem geeigneten Standort gestalte sich schwierig, schreibt die Stadt in der entsprechenden Beschlussvorlage. Die Stadt strebt eine Rettungswache in der Erweiterung des Gewerbegebiets Lembeck an. Durch die Anbindung an die K13 würden sich kürzere Wege nach Rhade und zur A31 ergeben. Allerdings würden mindestens fünf Jahre vergehen, bis der Bau fertiggestellt wäre. Planungsverfahren, Erschließung des Baufeldes, Objektplanung und Bau würden entsprechend viel Zeit in Anspruch nehmen. Da die Zeit drängte, hatte die Verwaltung Gespräche mit Investoren und Grundstückseigentümern geführt mit dem Plan, bereits bestehenden Fahrzeughallen zu nutzen. Diese Gespräche waren aber nicht erfolgreich. Deshalb soll nun eine Firmenfläche für acht Jahre gepachtet werden. Auch als finaler Standort der Wache wäre die Fläche geeignet. Allerdings sei der Eigentümer nicht bereit, diese zu verkaufen.
Für einen Neubau lag ein Angebot in Höhe von 1,04 Millionen Euro vor. Für die Baufeldherrichtung würden etwa 390.000 Euro fällig sowie 180.000 Euro für die Demontage und die Grundstücksräumung. Zudem wies die Stadtverwaltung darauf hin, dass ein Kauf der Module aufgrund der aktuellen Marktsituation günstiger sei, als diese zu mieten. Die monatliche Kaltmiete von 22.289,50 Euro würde sich aus der Grundstückspacht (316,67 Euro), den Zinsen und der Tilgung (19.829,97 Euro) sowie den Rückbaukosten (2.142 Euro) zusammensetzen. Die Finanzierung soll vollumfänglich über die Rettungsdienstgebühren erfolgen. Ein entsprechendes Einverständnis haben die Krankenkassen im September 2023 gegeben.
Tag des Notrufs: Patienten missachten oft edizinische Warnsignale
Bei Notfällen wie einem Schlaganfall oder Herzinfarkt zählt jede Minute. Notfälle müssen schnell bemerkt und behandelt werden. Ansonsten können sie weitreichende Folgen haben. Auch im Kreis Recklinghausen verzichten die Menschen nach Einschätzung der AOK NordWest immer öfter bei ersten Warnsignalen darauf, einen Notruf als wichtigste Sofort-Maßnahme abzusetzen. Aus einer Auswertung der AOK geht hervor, dass im Jahr 2022 beispielsweise bei Schlaganfallbehandlungen in Westfalen-Lippe 12,9 Prozent weniger Krankenhausbehandlungen festzustellen waren als 2019 vor der Pandemie. Dieser Negativtrend setzt sich auch 2023 fort. Allein im ersten Halbjahr 2023 lag das Minus im Vergleich zum Vorjahreszeitraum noch einmal bei 4,9 Prozent.
„Bei Notfall-Symptomen sollte nicht gezögert und umgehend der Notruf 112 gewählt werden“, appelliert AOK-Serviceregionsleiter Jörg Kock anlässlich des Europäischen „Tag des Notrufs“ am Sonntag, 11. Februar, an die Bevölkerung im Vest. Warnsignale sollten ernst genommen werden. Mögliche Symptome für einen Notruf können plötzlich auftretendes Schwäche- oder Taubheitsgefühl bis hin zu Lähmungserscheinungen einer Körperseite sein. Warnzeichen sind außerdem eine unverständliche, gestörte Sprache, plötzliche Sehstörungen, Schwindelgefühle oder Gleichgewichtsstörungen mit Übelkeit und Erbrechen sowie in Kombination plötzlich auftretende, bisher so nicht gekannte Kopfschmerzen. Für den Laien ist aber oft schwer zu beurteilen, wann ein Menschenleben akut bedroht ist. „Unwissenheit führt häufig dazu, dass gefährdete Patienten möglicherweise zu lange warten, ehe sie den Rettungsdienst kontaktieren“, so Kock. Im Ernstfall sollte daher sofort der Notruf unter 112 getätigt werden. Dabei sind Name und Adresse sowie Hinweise zum möglichst schnellen Auffinden des Patienten anzugeben. Die Symptome sollten möglichst genau geschildert werden.
- Auch das kann passieren: Notruf eines Zugreisenden im Bord-WC. Aus Ärger über fehlendes Klopapier hat ein Zugreisender bei Aachen den Notfall betätigt. Die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn hatte die Bundespolizei am Aachener Hauptbahnhof darüber informiert, dass in einem einfahrenden Zug mehrfach die Notfalleinrichtung betätigt worden sei. In der Regionalbahn trafen die Beamten einen 26-Jährigen an, der zugab, den Notrufknopf gedrückt zu haben. Als Grund sagte er, dass er sich geärgert habe, weil es im Bord-WC weder Toilettenpapier noch fließendes Wasser gegeben habe. Und die Toilette zudem nicht sauber gewesen sei. Seinen Unmut darüber habe er mit dem Betätigen der Notrufanlage zum Ausdruck bringen wollen. Der Mann erhielt eine Anzeige wegen Missbrauchs von Notrufen (dpa/SZ, 9. Febr. 2024).
Quellen: Michael Wallkötter in DZ vom 22. April 2017. – Online-Enzyklopädie Wikipedia (Aufruf 2017).– DZ vom 8. Dez. 2023. – Süddeutsche Zeitung, 9. Febr. 2024.