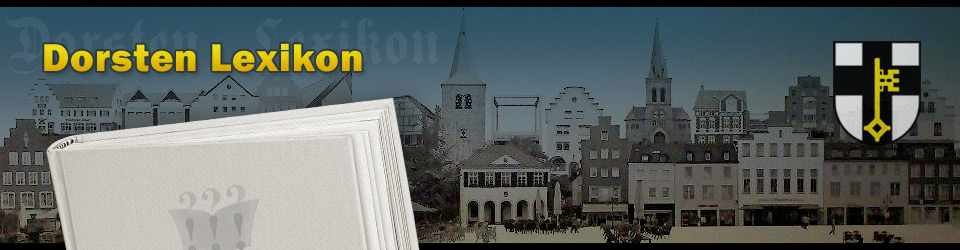Interaktive Onlinebeteiligung der Stadt startete im August 2022 mit Umfragen
 Zur zukünftigen Gestaltung einer nachhaltigen und klimafreundlichen Mobilität erstellt die Stadt Dorsten ab 2022 einen Mobilitäts-Entwicklungsplan (MEP). Um die Mobilität in Dorsten zukünftig nach den Wünschen der Bevölkerung gestalten zu können, ist die Beteiligung ein zentraler Baustein der Erstellung des MEP. In den ersten Monaten haben bereits die ersten Stadtteilworkshops stattgefunden. Mitte des Jahres fanden dann zwei Workshops statt: Mitte August 2022 der Stadtteilworkshop für die Stadtteile Wulfen und Deuten im Gemeinschaftshaus Wulfen. Zwei Wochen später konnte sich die Bevölkerung der Stadtteile Hervest und Holsterhausen im großen Sitzungssaal des Rathauses aktiv beteiligen. Neben der Beteiligung in den genannten Stadtteilworkshops bestehen zwei Online-Beteiligungsformate: eine Online-Beteiligungskarte sowie eine Online-Umfrage, in denen jederzeit anonym Ideen und Anregungen an die Stadt herangetragen werden können. In der Online-Umfrage, die bis Mitte September 2022 freigeschaltet war, bestand die Möglichkeit, Meinungen zur aktuellen Mobilitätssituation in der Stadt Dorsten und Wünsche für die Zukunft mit dem Projektteam zu teilen.
Zur zukünftigen Gestaltung einer nachhaltigen und klimafreundlichen Mobilität erstellt die Stadt Dorsten ab 2022 einen Mobilitäts-Entwicklungsplan (MEP). Um die Mobilität in Dorsten zukünftig nach den Wünschen der Bevölkerung gestalten zu können, ist die Beteiligung ein zentraler Baustein der Erstellung des MEP. In den ersten Monaten haben bereits die ersten Stadtteilworkshops stattgefunden. Mitte des Jahres fanden dann zwei Workshops statt: Mitte August 2022 der Stadtteilworkshop für die Stadtteile Wulfen und Deuten im Gemeinschaftshaus Wulfen. Zwei Wochen später konnte sich die Bevölkerung der Stadtteile Hervest und Holsterhausen im großen Sitzungssaal des Rathauses aktiv beteiligen. Neben der Beteiligung in den genannten Stadtteilworkshops bestehen zwei Online-Beteiligungsformate: eine Online-Beteiligungskarte sowie eine Online-Umfrage, in denen jederzeit anonym Ideen und Anregungen an die Stadt herangetragen werden können. In der Online-Umfrage, die bis Mitte September 2022 freigeschaltet war, bestand die Möglichkeit, Meinungen zur aktuellen Mobilitätssituation in der Stadt Dorsten und Wünsche für die Zukunft mit dem Projektteam zu teilen.
Karte zeigte 600 Einträge, wo Dorstener Verbesserungsbedarf sehen
Anfang April 2023 wurden die ersten Ergebnisse mit 631 Eintragungen präsentiert. Drei Bereiche haben die meisten „Likes“ bekommen – also die größte Zustimmung anderer Bürgerinnen und Bürger. Alle drei Top-Beiträge sind der Kategorie „Sicherheit/Optimierung“ zuzuordnen. Mit 115 Likes steht der Weg von der Gahlener Straße zum Ruderverein an der Spitze des Rankings. Ein beispielhaft aufgeführter Kommentar macht deutlich, warum. Der lose Schotterweg sei „insbesondere im Sommer viel durch Radfahrer und Autofahrer befahren“ und werde von Fußgängern genutzt. Durch die Nutzung würden sich „regelmäßig Schlaglöcher“ bilden. Dadurch gebe es ein hohes Verletzungsrisiko. Zusätzlich müsse die Stadt laufend die Kosten für die Ausbesserung tragen. Der Vorschlag: „An dieser Stelle wäre eine asphaltierte Oberfläche […] sinnvoll.“
Kreisverkehr bekam über 100 Likes
Auf 104 Likes – und damit auf Platz zwei – schaffte es ein Eintrag an der Haltener Straße/Fürst-Leopold-Allee. Dort komme es wegen zu hoher Geschwindigkeit regelmäßig zu Unfällen mit Verkehrsschildern, heißt es in dem Kommentar. Zudem würden einige Autofahrer beim Verlassen des Kreisverkehrs ihr Auto stark beschleunigen. Die Forderung: Kontrolle und Begrenzung der Geschwindigkeiten.
An der zentralen Dorstener Kreuzung Willy-Brandt-Ring/Vestische Allee gibt es den Eintrag mit den drittmeisten Likes. 82 an der Zahl. Es geht um die dortige Ampelschaltung. Diese sei laut des Kommentars unglücklich für Radfahrer: „Straßen NRW und die Stadt Dorsten sagen, dass der jeweils andere dies ändern könnte.“ Darüber hinaus gibt es noch viele weitere Einträge, die auch alle an die Stadt weitergeleitet und im Mobilitätsentwicklungsplan aufgenommen werden sollen. Allerdings könne man nicht versprechen, dass alle Anregungen und Vorschläge eins zu eins umgesetzt werden. Nach der Überprüfung entscheide die Politik über die einzelnen Maßnahmen.
Rad- und Autoverkehr dominierten thematisch
Die Themen Radverkehr (33 Prozent), Autoverkehr (28 Prozent) und Fußverkehr (20 Prozent) dominieren die Einträge auf der Mobilitätskarte. Nur neun Prozent der 631 Einträge lassen sich dem Bus- und Bahnverkehr zuordnen. Der Bereich E-Mobilität stellt mit drei Prozent nur einen Randaspekt dar. Zu finden sind die meisten Einträge in Wulfen (123). Es folgen die zentraleren Stadtteile Hardt (110), Altstadt (92) und Feldmark (82). Die wenigen Beiträge betreffen Deuten (17), Altendorf-Ulfkotte (16), und Östrich (13).
Zur Information:
Nach wie vor hat der motorisierte Individualverkehr eine Vorrangstellung
Vor dem Hintergrund starker Verkehrsbelastungen und hoher Schadstoff- und Lärmimmissionen soll mit einem Mobilitätsleitbild ein Prozess starten, der Mobilität neu organisiert. Die Stadt will gewährleisten, dass dies in einer modernen, zukunftsfähigen Form geschehen kann. Die veränderten Wertepräferenzen sowie die Herausforderungen einer nachhaltigen Wirtschaft zu einer neuen Gestaltungskraft für den Stadtraum wollen die Städte – und so auch Dorsten – kombinieren und nutzen, was auch zu Veränderungen führen wird. Die Mobilität soll dabei umfassender, vielfältiger verstanden werden, die Aufenthaltsqualität erhöht, die Ressourcen geschont und die Raumaufteilung gerechter werden. Der öffentliche Raum soll so gestaltet werden, dass das Gehen zu Fuß und das Radfahren eine neue Qualität erleben wird. Eventuell. Das betrifft den privaten Autoverkehr ebenso wie den öffentlichen Busverkehr. Die Verkehrsbelastung nimmt stets weiter zu. Nach wie vor hat der motorisierte Individualverkehr eine Vorrangstellung im Straßenverkehr. Von einer Gleichberechtigung der Verkehrsteilnehmer ist nicht zu sprechen, gegenseitige Rücksichtnahme wird oft vermisst. Ein Schlüssel für besseren Umwelt- und Klimaschutz, für weniger Lärm und Staus und eine lebenswerte Stadt ist die Reduzierung des Autoverkehrs auf Dorstens Straßen, die und ihre Ampelanlagen dem steigenden privaten Autoverkehr schon lange nicht mehr gewachsen sind. Zu reduzieren ist nicht nur der fließende Verkehr, sondern auch der Parkverkehr, denn die vom Auto belegten Flächen können und sollen anders genutzt werden. Etwa für Fuß- und Radwege oder für öffentlichen Raum, in dem Menschen miteinander interagieren.
Öffent. Fahrkomfort muss zunehmen, damit mehr auf den Bus umsteigen
Der Verzicht auf das eigene Auto muss aber auch attraktiv und machbar sein. Dazu muss sich auch der öffentliche Verkehr (ÖV) verändern; er muss seine Angebote deutlich ausweiten und sie kostengünstiger anbieten. Der Fahrkomfort, aber auch Kapazitäten müssen deutlich zunehmen, damit mehr Bürgerinnen und Bürger freiwillig vom Auto auf den Bus umsteigen. Hier hat der ÖV Potenzial, neue Fahrgäste zu gewinnen. Als Alternative zum Auto ist auch der Ausbau eines sicheren Radwegenetzes und der Fußwege zu sehen. Diejenigen, die ein berechtigtes Anliegen haben, mit dem Pkw ihr Ziel zu erreichen, sollen das auch weiterhin tun können, etwa um Unternehmen und Geschäfte beliefern oder (Pflege-)Dienstleistungen erbringen zu können. Doch ist Mobilität auch eine stadtplanerische Aufgabe. Denn Ziel muss es auch sein, Mobilität zu vermeiden. Die Digitalisierung macht es möglich, dass Menschen von Zuhause aus arbeiten, sodass Pendlerverkehre deutlich reduziert werden können. Wenn in Stadtquartieren wieder alle Angebote des täglichen Bedarfs (Einkaufen) und öffentliche Einrichtungen wie Schulen und Kindertagestätten fußläufig erreichbar sind, entfällt die Notwendigkeit, längere Wege mit dem Auto zurücklegen zu müssen. Für all das sind neue Mobilitätskonzepte nötig, die nicht an den Stadtgrenzen Wiesbadens enden dürfen. Hier sind Kooperationen mit anderen Kommunen und auf Kreis-, Landes- und Bundesebene nötig, etwa für Fahrrad(schnell)wege, Ladestationen oder P+R-Plätze. Das Mobilitätsleitbild soll daher der Auftakt und das Mittel sein, um Verkehrsstrukturen zu ändern und Ideen zu pilotieren. Weil sich nicht in einem Zuge die gesamte Stadt umbauen lässt, sollen Experimente in abgegrenzten Stadträumen durchgeführt und bei Erfolg ausgeweitet werden. Hierfür braucht es Mut zur Vision und Mut, Dinge zu ändern. Nun muss der Prozess starten – in einem ideologiefreien Miteinander, so die Erwartungshaltung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Leitbildprozess.