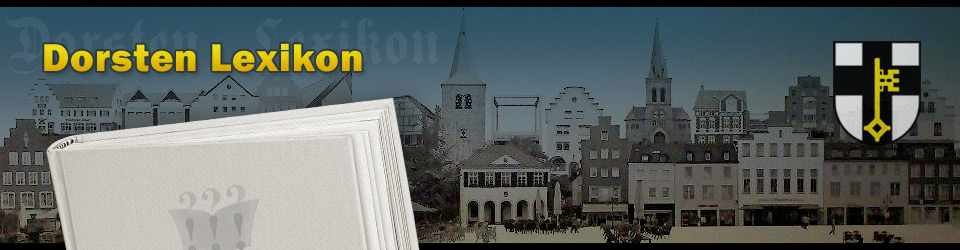Bundesregierung setzt die von Olaf Scholz ausgerufene „Zeitenwende“ fort
In ihrem Koalitionsvertrag 2025 haben CDU, CSU und SPD einige Maßnahmen festgehalten, um Deutschland besser gegen Cyberangriffe, Desinformation und Kriegsgefahren zu rüsten. Ein Überblick. – Die Bundesregierung will die 2022 von Olaf Scholz ausgerufene „Zeitenwende“ fortsetzen und auch im Innern stärker als bisher vorantreiben. In ihrem Koalitionsvertrag haben sich CDU, CSU und SPD dazu auf eine Reihe von Vorhaben und Projekten geeinigt, die nicht nur die klassische Verteidigungspolitik betreffen. Einige der Vorhaben hatte sich bereits die Ampelkoalition 2021 ähnlich überlegt. Viele der Pläne bleiben im Koalitionsvertrag zunächst vage, wie sie konkret ausgestaltet und ob sie tatsächlich umgesetzt werden, ist offen. Die Schwerpunkte und Neuausrichtungen lassen sich jedoch erkennen:
Nationaler Sicherheitsrat: CDU, CSU und SPD wollen einen Nationalen Sicherheitsrat im Bundeskanzleramt einrichten. Damit setzen sie eine Forderung um, die seit Jahren von vielen Sicherheits- und Verteidigungsexperten, aber auch von CDU und CSU erhoben wird. Der Sicherheitsrat soll Deutschland im Krisenfall schneller und koordinierter handlungsfähig machen. Das Gremium soll die deutsche Sicherheitspolitik koordinieren, Strategien entwickeln und Lagebilder erstellen. Dem Rat sollen die für die innere und äußere Sicherheit zuständigen Bundesminister, Vertreter der Länder und der relevanten Sicherheitsbehörden angehören.
Kampf gegen Desinformation: Union und SPD wollen den Kampf gegen Desinformation ausbauen. „Gezielte Einflussnahme auf Wahlen sowie inzwischen alltägliche Desinformation und Fake News sind ernste Bedrohungen für unsere Demokratie, ihre Institutionen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt“, heißt es im Koalitionsvertrag. Ebenfalls in das Dokument geschafft hat es ein Satz, der schon nach dem Bekanntwerden der Arbeitsgruppen-Papiere während der Koalitionsverhandlungen für Kritik gesorgt hatte: „Die bewusste Verbreitung falscher Tatsachenbehauptungen ist durch die Meinungsfreiheit nicht gedeckt.“ Von Kritikern wird der Satz so verstanden, als wollten die Koalitionäre die Meinungsfreiheit durch Rechtsverschärfungen einschränken.
Der Koalitionsvertrag führt dazu weiter aus, „die staatsferne Medienaufsicht“ müsse unter Wahrung der Meinungsfreiheit auf Basis klarer gesetzlicher Vorgaben „gegen Informationsmanipulation sowie Hass und Hetze vorgehen können“. Den massenhaften und koordinierten Einsatz von Bots und Fake Accounts will die Koalition verbieten. Dabei sollen auch die Online-Plattformen stärker in die Pflicht genommen werden. Der Europäische Digitale-Dienste-Akt (DSA) soll „stringent umgesetzt und weiterentwickelt“ werden. Außerdem wollen die Koalitionäre die digitalen Kompetenzen der Bevölkerung stärken, „um allen Menschen gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen und unsere Demokratie resilienter gegen Desinformation und Manipulation zu machen“.
Cybersicherheit: Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) soll zu einer Zentralstelle für Fragen der Informations- und Cybersicherheit ausgebaut werden – das hatte die Ampelkoalition in ihrem Koalitionsvertrag 2021 allerdings auch schon festgeschrieben. Die Kommunikationsnetze des Bundes sollen gehärtet und das Nationale Cyber-Abwehrzentrum soll fortentwickelt werden. Union und SPD einigten sich auch auf einen unter IT-Sicherheitsexperten kontrovers diskutierten Vorstoß: Sie wollen „im Rahmen des verfassungsrechtlich Möglichen“ die Fähigkeiten zu „aktiven Cyberabwehr“ ausbauen. Dabei geht es etwa darum, bei Cyberangriffen nicht nur die eigene Infrastruktur zu schützen, sondern auch technische Infrastruktur der Angreifer zu übernehmen oder durch Gegenangriffe auszuschalten. Im Zuge der Umsetzung der europäischen Cybersicherheitsrichtlinie NIS-2 soll das BSI-Gesetz novelliert werden. Die deutschen Nachrichtendienste sollen sich künftig stärker gemeinsam auf den „Cyber- und Informationsraum“ ausrichten – „auch durch die Schaffung einer neuen spezialisierten technischen Zentralstelle unter Einbeziehung von ZITiS“ (Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich).
Bevölkerungsschutz und Vorbereitung auf Kriegsgefahren: In ihrem Koalitionsvertrag bekennen sich Union und SPD dazu, nicht nur die Sicherheitsbehörden, sondern auch den Zivil- und Katastrophenschutz zu stärken. Dafür sollen auch die „neuen Finanzierungsinstrumente zugunsten von Bund und Ländern“ herangezogen werden – damit ist das noch vom alten Bundestag verabschiedete Schuldenpaket für Investitionen und Verteidigungsausgaben gemeint. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) soll als zentrale Stelle für den Zivil- und Katastrophenschutz und das Technische Hilfswerk als „operative Einsatzorganisation“ gestärkt werden. Die Maßnahmen der künftigen Regierung sollen in einem „Pakt für den Bevölkerungsschutz“ gebündelt werden. Die Koalition in spe will auch die Rechtslage in der Zivilen Verteidigung ändern – um „Handlungsfähigkeit bereits vor dem Spannungs- und Verteidigungsfall“ zu ermöglichen. Sicherheits- und Zivilschutzbehörden und Bundeswehr sollen stärker zusammenarbeiten. Die wenig bekannten Sicherstellungs- und Vorsorgegesetze sollen ebenfalls novelliert werden, um Zuständigkeiten im Krisenfall klarer zu regeln. Während die Vorsorgegesetze auf innere Notlagen wie Naturkatastrophen abzielen, gelten die Sicherstellungsgesetze im Verteidigungsfall, etwa bei der Zuweisung ziviler Unterstützungspflichten. Zudem plant der Bund, die rechtlichen Grundlagen für eine bessere Drohnendetektion und -abwehr durch Bundes- und Landesbehörden zu schaffen.
Siehe auch: Olaf Scholz
Quelle: Felix Huesmann in RN (DZ) vom 12. April 2025