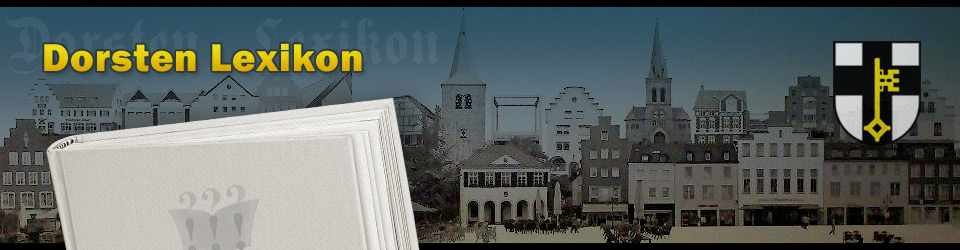Heiligabend der bestbesuchte Gottesdienst-Tag des ganzen Jahres
Bisher konnten sich die Gemeinden sicher sein: Weihnachten ist das Haus voll. Doch inzwischen lockt selbst das publikumswirksamste Fest der Christenheit nicht mehr wie früher. Wie wird diese Entwicklung weitergehen? Früh da zu sein, lohnt sich am Heiligabend noch immer. Vor ein paar Jahren war es noch so, dass diejenigen, die erst kurz vor Gottesdienstbeginn in der Kirche ankamen, auch mal stehen mussten. Jetzt sichert rechtzeitiges Erscheinen immerhin noch einen guten Sitzplatz mit Blick zum Altar. Etliche der fast fünf Millionen Kirchbesucherinnen und -besucher, die allein die evangelischen Landeskirchen am 24. Dezember zu ihren rund 34.000 Christvespern und Metten erwarten, werden mit Plätzen hinter Säulen oder auf verwinkelten Emporen vorliebnehmen müssen. Ähnlich voll werden dürfte es zum Fest auch in den katholischen Kirchen. Zwar nicht mehr heillos überfüllt wie früher. Aber immer noch ist der Heiligabend der bestbesuchte Tag des ganzen Jahres in den Gemeinden. Das ist eine merkwürdige Ausgangslage: Sollen sich die Kirchen über den Zulauf an dem einen Tag freuen? Oder sollten vielmehr alle Alarmglocken läuten? Die Antwort darauf ist alles andere als einfach. Mit pessimistischer Grundhaltung kommt man schnell zu der These, dass sich der Trend zum Besucherschwund fortsetzen wird. Es wäre nicht gut bestellt um das bisher publikumswirksamste Fest der Christenheit.
Besuch des Weihnachtsgottesdienst nur weil es Tradition ist?
Was für eine solche skeptische Lesart spricht, ist auch der Fakt, dass die Christvesper oder Mette der einzige Gottesdienst sein wird, an dem die meisten Besucherinnen und Besucher binnen Jahresfrist teilnehmen werden. Selbst diesen einen Gottesdienst besuchen sie – selbstredend – nicht unbedingt aus tieferer religiöser Überzeugung, wie eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im vergangenen Jahr bestätigt hat. Nur 38 Prozent führten ihren Glauben als Motiv an. 49 Prozent der Befragten sagten, dass der Kirchgang an Weihnachten für sie schlichtweg familiäre Tradition sei. Sie besuchen den Gottesdienst an Heiligabend, weil sie das schon als Kind immer getan haben. Oder weil man in der Kirche die Worte hört, ohne die es nicht weihnachtlich wird: „Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste.“ Immerhin 29 Prozent der Befragten gaben das Weihnachtsevangelium als den ausschlaggebenden Grund für den Besuch eines Heiligabendgottesdienstes an.
Doch besonders feierlich sind Gottesdienste am 24. Dezember oft nicht
Es ist vermessen, die Verantwortung dafür allein den „Weihnachtschristen“ in die Schuhe zu schieben. Geringschätzig auf die Gottesdienstbesucher herabzublicken, die nicht wissen, wann sie aufstehen und wann sie sitzen bleiben sollen, verbietet sich. Es ist vielmehr eine Kombination aus mehreren Faktoren, die an diesem Tag zusammenkommen, die oft keine wirkliche Andacht aufkommen lässt. Das fängt bei der liturgischen Ausschmückung an: Kyrie-Ruf und Glaubensbekenntnis – vielfach weggekürzt. Dazu predigt Gottes irdisches Bodenpersonal an diesem Abend leicht verdaulich. Es quengeln ein paar Kinder, die verständlicherweise das Geschenkeauspacken im Anschluss nicht erwarten können. Heilige Grundunruhe statt heiliger Nacht. Weihnachtsschlager reiht sich an Weihnachtsschlager, was oft noch der beste Teil der Veranstaltung ist. Und nach dem Segen schmettert die Gemeinde, wenn sie halbwegs textsicher ist, „O du fröhliche“. Für den Rest steht‘s ja auf dem Liederzettel.
Aus den kleinen Rituale wird Weihnachten ein „Alle Jahre wieder“-Fest
Der Kirchgang ist Teil dieser Tradition, selbst gespickt mit eher formelhaften, bloß nicht zu fremden Zeremonien, möglichst breit anschlussfähig und vor allem unverfänglich. Die Kirche: mehr Kulisse als tragende Handlung. Um möglichst vielen zu gefallen, übt sich die Kirche vielfach in zeremonieller Selbstbeschränkung. Wer es zumindest ein wenig andächtiger möchte, muss auf die späteren Gottesdienste in der Heiligen Nacht oder auf den ersten Feiertag ausweichen. Sich nun aber nur kirchenkulturpessimistisch darüber zu beklagen, wie sinnentleert das Fest heutzutage ist, greift zu kurz. Zumal schon Martin Luther als Erfinder des weltlichen Parts von Weihnachten gelten muss: Hat der große Reformator doch höchstselbst das Kinderleinbescheren vom Nikolaustag auf den Heiligen Abend verlegt. Natürlich ist Weihnachten auch für gläubige Christinnen und Christen beides – der theologisch gehaltvolle Geburtstag Jesu und ein Fest, an dem man zusammenkommt, gemeinsam isst und auch mal streitet.
Reformen tragen kaum Früchte
Vielmehr müssen wir uns in anderer Hinsicht nichts vormachen. Die noch weitgehend gut besuchten Gottesdienste zu Weihnachten sollten nicht kaschieren, was im Zensus bereits offensichtlich ist: Katholiken und Protestanten machen nur noch rund die Hälfte der Bevölkerung aus. Und auch von diesen gehen die allermeisten kaum noch zu Gottesdiensten. Die Prozentzahl der Gemeindemitglieder, die sonntags in den Kirchenbänken sitzen, liegt in beiden Konfessionen im niedrigen einstelligen Bereich. Schon seit Jahren fachsimpeln die Kirchenverantwortlichen, wie sie wieder mehr Menschen in die Gottesdienste locken können. Der Blick auf die Statistik zeigt, dass auch veränderte Uhrzeiten, andere Musik und kürzere Predigten den Besucherschwund nicht haben aufhalten können. Im Gegenteil muss die Kirche vielmehr aufpassen, nicht zu viel von ihrem originären Kern über Bord zu werfen im Versuch, die breite Masse zu erreichen. Denn auch zu Weihnachten sinkt die Nachfrage – und mit ihr auch das Angebot: Nach den Pandemiewintern 2020 und 2021 mit den zugehörigen Covid-Auflagen gab es zu Heiligabend 2022 in den evangelischen Kirchen im Lande immerhin wieder 34.329 Gottesdienste, wie die EKD fein säuberlich protokolliert hat. Zehn Jahre zuvor waren es allerdings noch 38.283. Von offizieller Seite hört man, dass weniger Gottesdienste in den Kirchen nicht per se etwas Schlechtes sein müsse: Der Wegfall einer nachmittäglichen Christvesper erlaube es dem Gemeindepastor mitunter, in einem Krankenhaus oder in einem Altenheim eine Andacht zu feiern. Orte, an denen die Menschen sonst auf die Übertragung in Radio und Fernsehen oder einen Stream im Internet zurückgreifen müssten. Und generell: Diese modernen Formen der Verkündigung nutzten heutzutage ja auch mehr Menschen. So rechnet sich so mancher die schwindenden Besucher in den Kirchen schön.
Gottesdienste verzeichnen eklatanter Bedeutungsverlust
Es mag zwar richtig sein, dass heutzutage mehr Menschen den Gottesdienst per Stream nutzen. Die Besucherstatistiken zu Weihnachten kann die neue Technik jedoch wohl nicht komplett erklären. Kamen 2022 exakt 4.922.759 Frauen und Männer, waren es 2012 noch 8.484.203. Ein Minus von mehr als 40 Prozent. Auch in Relation zu den Kirchenmitgliedern ist der Rückgang immens: Ließen sich 2012 statistisch noch 35,9 Prozent der eingeschriebenen Schäfchen zur Geburt des Herrn in der Kirche blicken, waren es ein Jahrzehnt später nur noch ein Viertel. Wobei diese Angabe mit Vorsicht zu genießen ist: Geht man davon aus, dass zum Fest auch Nicht-Mitglieder in den Gottesdiensten dabei sind, liegt die Quote sogar noch darunter. Immer weniger Gläubige, noch viel weniger Kirchgänger, immer simplere Liturgien und Gottesdienste. Es mutet so an, als ob diese Aspekte einander verstärken und verstärken – geradezu ein sprichwörtlicher Teufelskreis. Damit gerät im einst christlichen Abendland zusehends eine spirituelle Struktur in Vergessenheit, die Menschen über Jahrhunderte Halt und Orientierung gegeben hat: das Kirchenjahr mit seiner festen Abfolge an Festen, die gleichsam wie die Jahreszeiten einem übergeordneten Rhythmus folgen. Schon in den ersten Jahrhunderten nach Christus hat es sich herauskristallisiert. Weihnachten und Ostern – das sind seine offensichtlichen Eckpfeiler. Zwar weisen protestantische, katholische und orthodoxe Kirchenjahre einige Unterschiede auf, doch überwiegen die Gemeinsamkeiten.
Lieder als Teil eines Schatzes
Der Soundtrack für die Reise durch diesen Jahresablauf steht seit genau 500 Jahren im Gesangbuch. Dieses runde Jubiläum konnte die evangelische Kirche in diesem Jahr feiern. Gerade im Advent und zu Weihnachten stehen viele der traditionellen Melodien und Texte hoch im Kurs: von „Macht hoch die Tür“ über „Es ist ein Ros’ entsprungen“ und „Vom Himmel hoch“ bis hin zu „Stille Nacht“. Das sind die Lieder, die die Menschen am Heiligabend singen wollen. Gerade wegen dieser Lieder kommen viele in die Gottesdienste. Sie können ein Schlüssel sein, sich den größeren theologischen Zusammenhang zu erschließen. Und solche Klassiker gibt es auch jenseits von Weihnachten. Luthers „Ein feste Burg ist unser Gott“ etwa oder „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“ von Paul Gerhardt. Diese Lieder dürften auch in Generationen noch in Gottesdiensten gesungen werden. Dass sie im neuen evangelischen Gesangbuch, das gerade erarbeitet wird, enthalten sein werden, ist gesetzt. Im Advent 2028 soll es in den Kirchenbänken liegen.
Nur eine Kerngemeinde wird dann jedoch davon überhaupt Notiz nehmen. Immerhin, ganz verloren gehen wird dieser Teil unseres kulturellen Erbes dank dieser nicht. Denn eine repräsentative Weihnachtsstudie der Universität der Bundeswehr München aus dem vergangenen Jahr hat herausgearbeitet, dass nach wie vor gerade junge Menschen zu Weihnachten in die Kirche gehen. Und ein Teil davon wird sicher auch in späteren Jahren wiederkommen, weil diese Menschen es „immer schon so gemacht“ haben.
Außerdem hat Bundeswehr-Professor Philipp A. Rauschnabel herausgefunden, dass gerade optimistische Menschen an den Weihnachtsgottesdiensten teilnehmen. Also die, die sagen, in Politik, Gesellschaft und Umweltschutz wird sich langfristig alles schon noch irgendwie zum Guten entwickeln.
Vielleicht ist das die neue weihnachtliche Hoffnung dieser Tage: dass auch in Zukunft noch Menschen wie ehedem zur Kirche gehen und Gottesdienst feiern werden. Und so ein uraltes Kulturgut fortführen. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste aus dem Lukas-Evangelium.
Quelle: RN (DZ) vom 22. Dezember 2024